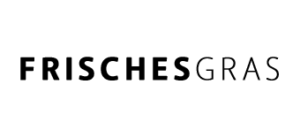Die Gasometer sind faszinierende Denkmäler einer längst vergangenen Zeit. 1896-1899 errichtet, hatten die Bauwerke bis 1986 ihre ursprüngliche Funktion als Gasspeicher erfüllt. Danach wurde es still um die vier Gasriesen – sie verfielen in einen langen Dornröschenschlaf. Erst in den 1990er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde laut über eine neue Nutzung der unter Denkmalschutz stehenden Bauwerke nachgedacht. 1999 – also gut hundert Jahre nach der ersten Geburt – wurde der Startschuss für ein außergewöhnliches Projekt gegeben: der Umbau zu einem modernen Wohn- und Geschäftszentrum.
Der französische Stararchitekt Jean Nouvel wollte das Innere des Gasometer A nicht verbauen, sondern ihn mit einem eigenen Baukörper aufwerten. Ihm war es wichtig, visuelle Leichtigkeit durch die Verwendung von Glas und spiegelndem Stahl zu vermitteln und eine Synergie zwischen der alten bestehenden Außenmauer des Gasometers und der neuen Konstruktion zu schaffen.
Das markante Erkennungszeichen des Gasometer B ist der nördlich angelehnte Zubau in Form eines Schildes. Architekt Wolf D. Prix vom Team Coop Himmelb(l)au wollte mit diesem Projekt moderne Akzente in den Gasometern setzen und das Gebäude durch den markanten Zubau («Schild») in seiner nutzbaren Wohnfläche vergrößern.
Der Gasometer C, ausgestaltet von Manfred Wehdorn, besticht in mehrfacher Hinsicht: traditionelle Wiener Bauweise, viel Grün und ein Platz der Geselligkeit. Ein groß angelegter treppenförmiger Hof in Form eines Atriums ist das Zentrum des Gasometer C. Das ermöglicht Lichteinfall bis in die unteren Etagen im Innnehof.
Architekt Wilhelm Holzbauer ging als einziger den umgekehrten Weg. Er verbaute den Gasometer von innen nach außen, in Sternform. So entstanden drei Innenhöfe mit Gärten in 35 Metern über der Straße und Blick über Wien.